
EPAC-Grenzen - Schutzschirm oder Bremsklotz?
Lieber SAZbike Leser,
Stärker, stabiler, souveräner - das E-Bike hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung erfahren. Das ist fantastisch. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille: Mit jedem Technologiesprung nähert sich das Elektrofahrrad der motorisierten Welt an.
Die Krux: Je kleiner dieser Abstand wird, desto genauer schaut die Politik hin - inzwischen so aufmerksam, dass das Thema längst in Brüssel angekommen ist. Dort wird nun um neue Leitplanken für EPACs (Electronically Power Assisted Cycles) gerungen - mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen für die E-Bike-Industrie.
Und die Fahrradbranche selbst? Die diskutiert fleißig. Während die einen klare Grenzen als Schutzschild sehen, fürchten andere einen schweren Rückschritt. Höchste Zeit also, genauer hinzuschauen, was die neuen Regeln wirklich bedeuten könnten. Dieser Premium-Newsetter macht genau das.
Viele Grüße
Werner Müller-Schell
Redakteur SAZbike

Werner Müller-Schell
Redakteur, SAZbike
Hintergrund & Anlass

Kaum ein Verkehrsmittel hat die Mobilität in Europa so stark verändert wie das E-Bike. Über 16 Millionen Fahrzeuge sind allein in Deutschland im Einsatz - vom Pendelrad bis zum Lastenbike, vom Tourenmodell bis zum SUV-E-Bike. Was sie alle verbindet, ist ein entscheidender Vorteil: Sie gelten rechtlich als Fahrräder. Keine Zulassung, kein Versicherungskennzeichen, keine Helmpflicht - das macht sie unkompliziert, erschwinglich und massentauglich.
Doch genau dieser Status gerät durch immer leistungsstärkere Systeme unter Druck - und macht das E-Bike immer öfter zum Gegenstand politischer Debatten. Der Branchenverband ZIV - Die Fahrradindustrie hat deshalb einen Vorschlag vorgelegt, der die Grenze zum Kraftfahrzeugrecht schärfen soll.
In der Branche gibt es allerdings auch Widerstand gegen den ZIV-Vorschlag. Die europäische Light Electric Vehicle Association (Leva-EU) hat Anfang September mit einem offenen Brief an ZIV, Conebi (Confederation of the European Bicycle Industry; Anm. d. Red.) und die EU-Kommission eine Gegenkampagne gestartet. Kürzlich teilte die Brüsseler Organisation mit, dass bereits fast 200 Personen den offenen Brief unterschrieben hätten. Auch manche Hersteller beurteilen den ZIV-Kurs als zu restriktiv.
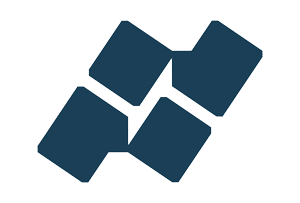
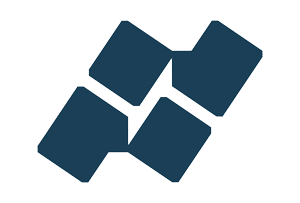
Was ist geplant?
Mit einer definierten Obergrenze von 750 Watt Spitzenleistung, einem maximalen Unterstützungsverhältnis von 1:4 und einem zulässigen Gesamtgewicht von 250 Kilogramm für einspurige Fahrzeuge bzw. 300 Kilogramm für mehrspurige EPACs soll der rechtliche Fahrradstatus abgesichert werden.
Ziel sei es, so die Verantwortlichen des ZIV, eine klare Grenze zwischen Fahrrädern und Kraftfahrzeugen zu ziehen - ohne Innovation zu bremsen.
Zahlen & Eckpunkte
- Bestand EPAC in Deutschland: knapp 16 Mio. Fahrzeuge.
- ZIV-Leitplanken: 750 W Peak, 1:4 Unterstützung, 250/300 kg zGG (ein-/mehrspurig).
- Mehrheit im Verband mit über 80 % Zustimmung.
- Marktbild laut ZIV: Über 95 % der Modelle unterhalb der Maximalleistung.
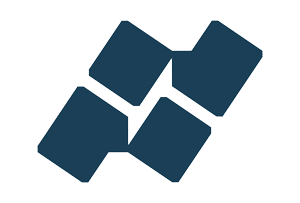
Was bedeutet das für Handel und Industrie?
Für Handel und Industrie steht viel auf dem Spiel: Sollte die EU die Regulierung im Sinne des ZIV verschärfen, würde das einerseits für klare Rahmenbedingungen sorgen - und damit für Planungssicherheit bei Entwicklung, Zulassung und Vertrieb. Hersteller könnten ihre Produktportfolios gezielter ausrichten, Händler hätten eine eindeutige Argumentationsbasis gegenüber Kunden.
Andererseits drohen Innovationsbremsen: Leistungsstärkere oder spezialisierte Fahrzeuge - etwa schwere Cargobikes oder Inklusionsmodelle - könnten künftig unter strengere Auflagen fallen und an Attraktivität verlieren. Für die Industrie bedeutet das potenziell höhere Kosten und längere Entwicklungszyklen, für den Handel weniger Vielfalt und komplexere Beratungsprozesse. Der Ausgang der Debatte wird daher entscheidend dafür sein, ob Europa seinen Innovationsvorsprung im E-Bike-Segment halten oder an dynamischere Märkte verlieren kann.

Stimmen
Die ZIV-Spitze und eine große Mehrheit der Mitgliedsunternehmen tragen die Leitplanken. Politisches Ziel: die Gleichstellung mit dem Fahrrad sichern und unklare Ausreißer verhindern.
Tim Salatzki (Leiter Technik/Normung, ZIV) führt als Beleg die Marktrealität an: "Die vorgeschlagenen Parameter bilden den Status quo ab. Über 95 Prozent der verkauften Modelle liegen unterhalb der genannten Maximalleistung. Kurzum: Wir präzisieren, was sich bewährt hat und schließen Grauzonen, um Akzeptanz und Sicherheit zu erhalten."
Der Gegenwind kommt vor allem aus zwei Richtungen - zum einen von Interessenverbänden aus Brüssel und Deutschland, zum anderen aus Teilen der Industrie.
Leva-EU warnt, der Vorschlag dränge "zahllose Fahrzeuge" in die L-Kategorie nach EU-VO 168/2013 - mit Folgen besonders für Cargobikes, Inklusionsfahrzeuge und innovative Leichtfahrzeuge. Statt neuer Watt-/Gewichtsgrenzen plädiert die Organisation für einen technologieneutralen LEV-Rechtsrahmen; EN 15194 und Maschinenrecht böten bereits Sicherheit und Klarheit.
Hepha-Geschäftsführer Alex Thusbass hält die 750-Watt-Grenze für praxisfern. Unter Volllast zähle Beschleunigung, nicht Watt: "Ein Cargobike mit 750 Watt geht bei voller Beladung in die Knie." Zudem drohe ein Standortnachteil durch zu enge Limits.
Der Radlogistik Verband Deutschland (RLVD) fordert, kommerzielle Cargobikes als Fahrräder zu erhalten, und plädiert für technisch messbare Sicherheitskriterien (z. B. Bremsweg, Anfahrbeschleunigung) statt abstrakter Wattgrenzen sowie eine Einbettung auf Basis der DIN-EN-17860-Reihe (Cargobike-Sicherheitsnorm, seit 2024/25 in Kraftsetzung).
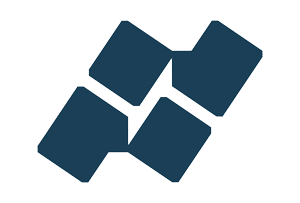
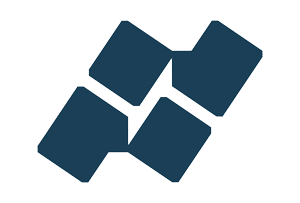

Praxisstreit & Dilemma
In der Praxis kollidieren drei Logiken:
- Politische Logik: Der Fahrradstatus trägt die Massennutzung. Fällt er, drohen dem E-Bike Zulassung, Versicherung, Helmpflicht - das wären hohe Hürden für den E-Bike-Verkauf. Das Pro-Lager will mit klaren Leitplanken eine Überreaktion der Politik vermeiden.
- Technische Logik: Watt ist nicht Fahrdynamik. In Lasten-Szenarien entscheiden Anfahrmomente, Verzögerung und Stabilität - Kriterien, die sich messen lassen. Deshalb werben Kritiker für Prüfgrößen wie Bremsweg und Anfahrbeschleunigung statt abstrakter Watt-Deckel.
- Wirtschaftliche Logik: Einheitliche Leitplanken reduzieren Prüf- und Haftungsrisiken, geben Einkauf und Entwicklung Korridore - können aber Nischen und Innovationen beschneiden, wenn Segmente in L-Kategorien rutschen. Leva-EU warnt vor Rückschritten in der städtischen Logistik, wenn Cargobikes aus EPAC fallen und Kommunen zurück zu Vans müssten.
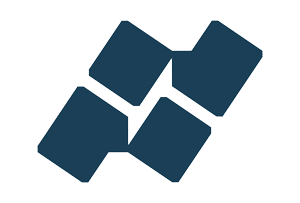
Lösungsweg oder neue Baustelle?
Die ZIV-Leitplanken sind politisch anschlussfähig: leicht erklärbar, mehrheitsfähig, mit Status-quo-Deckung. Doch als reine Watt- bzw. Gewichtsgrößen bleiben sie angreifbar, wenn harte Praxisfälle (Volllast-Anfahrt am Berg, Mischverkehr, Notbremsung) nicht abgebildet werden. Die Gegenseite riskiert mit Normverweisen allein (EN 15194, Maschinenrecht), die Grauzonen zu belassen, die die Politik erst aufmerksam machen.
Ein Hybrid liegt auf der Hand: einfach kommunizierbare Leitplanken zur Statussicherung, ergänzt um fahrdynamische Mindestkriterien (zum Beispiel Anfahrbeschleunigung, Bremsweg) für Last- und Spezialfälle. Ob Brüssel diesen Weg geht, ist offen - erst weitere Kommissionsschritte würden den Pfad zu einem Legislativvorschlag klären.
In den kommenden Monaten wird sich entscheiden, welche Richtung die europäische Regulierung einschlägt. Die EU-Kommission arbeitet derzeit an der sogenannten PMD Directive (Personal Mobility Devices), die E-Bikes, Lastenräder und Mikromobilitätsfahrzeuge unter einem gemeinsamen rechtlichen Rahmen zusammenführen soll. Ein erster Entwurf wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet - dann dürfte sich zeigen, inwieweit die Positionen des ZIV oder der LEVA-EU Einfluss finden.
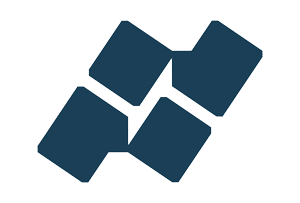
Fazit & Aufruf zur Diskussion

Die Debatte um die EPAC-Regulierung zeigt, wie tief die europäische Fahrradbranche in diesem Punkt weiterhin gespalten ist - und wie groß die Herausforderungen sind, einheitliche Regeln für ein Produkt zu schaffen, das zwischen Mobilitätsform und Fahrzeugklasse steht.
Entscheidend wird sein, ob es gelingt, in Brüssel eine Lösung zu finden, die sowohl Rechtssicherheit als auch Entwicklungsspielraum bietet. Denn nur dann kann das E-Bike bleiben, was es geworden ist: das Rückgrat einer neuen, klimafreundlichen Alltagsmobilität.
Wie lässt sich eine faire Struktur schaffen, ohne ein Erfolgsmodell zu gefährden?
👉 Diskutiere mit - direkt im Kommentarbereich auf LinkedIn im SAZbike-Profil!
Du willst mehr hiervon?
Dann jetzt den PREMIUM NEWSLETTER abonnieren.
Er liefert dir jede Woche:
✅ Tiefgreifende Marktanalysen und Trendprognosen
✅ Exklusive Interviews mit Branchenexpertinnen und -experten
✅ Strategische Einordnung aktueller Entwicklungen
✅ Kompakte Aufbereitung – in nur 10 Minuten Lesezeit
